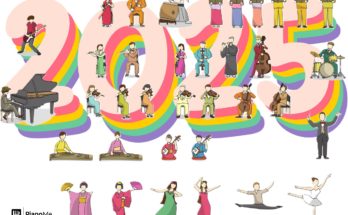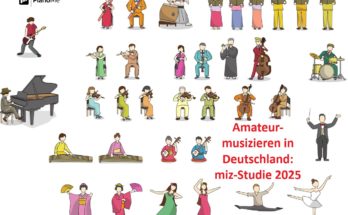Die Bundestagswahl steht für viele Bürger:innen im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Entscheidungen bei Wahlen prägen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Zukunft unseres Landes. Ein Bereich, der jedoch nach wie vor zu wenig Beachtung findet, ist die Kulturpolitik. Dabei zeigen andere Länder, wie Kulturpolitik zu einem festen Bestandteil der Wahlprogramme werden kann.
In Frankreich beispielsweise zählen der Schutz und die Förderung von Kultur zu den zentralen Themen fast jeder Wahl. Auch in Skandinavien genießt die Kulturpolitik hohen Stellenwert: Dort fließen beträchtliche Mittel in öffentliche Bibliotheken, Festivals und die Förderung junger Künstler:innen.
In Deutschland hingegen ist Kulturpolitik überwiegend Ländersache, was die Umsetzung eines bundesweiten Kulturprogramms erschwert. Dabei hat Kulturpolitik das Potenzial, eine Gesellschaft nachhaltig zu prägen und zu stärken. Zwar finden sich in den Wahlprogrammen einige Ansätze zur Kulturförderung auf Bundesebene – darunter der Erhalt der Künstlersozialkasse, die Reform der Filmförderung oder die Stärkung der Kreativwirtschaft. Dennoch bleibt der Eindruck, dass Kulturpolitik häufig als Randthema behandelt wird.
Auch aus der Kulturszene selbst kommen zunehmend Forderungen nach konkreten Maßnahmen. Ein zentrales Anliegen ist die Verbesserung der sozialen Absicherung für freischaffende Künstler:innen. So war dies etwa Thema in unserem Interview mit Cilgia Gadola vom Bundesverband Freie Darstellende Künste e.V. (BFDK). Besonders die unzureichende Arbeitslosenversicherung für Selbstständige sorgt in der Branche für Kritik. Im Forschungsprojekt „Systemcheck“ wurden hierzu drei zentrale Empfehlungen entwickelt:
- Selbstständige sollten einen erleichterten Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung (ALV) erhalten.
- Hybriderwerbstätige sollten ihre Beiträge zur freiwilligen ALV mit Pflichtbeiträgen aus der Arbeitslosenversicherung kombinieren können.
- Eine eigenständige, verpflichtende Absicherung gegen atypische Einkommensausfälle sollte in die Künstlersozialversicherung integriert werden.
Auch andere Themen sorgten im vergangenen Jahr für Diskussionen: Die Folgen des Herrenberg-Urteils, die Umsatzsteuerbefreiung für Musikunterricht und die weiterhin unklaren Grenzen zwischen Angestelltenstatus und Honorartätigkeit verdeutlichen den Handlungsbedarf.
Ein weiteres Problem ist die fehlende Infrastruktur: Proberäume sind in vielen Städten Mangelware. Zahlreiche Studien, Recherchen und laufende Verfahren belegen zudem die prekäre Lage vieler Kulturschaffender – und den dringenden politischen Handlungsbedarf.
Ein Blick in die Parteiprogramme zeigt immerhin eine gewisse Einigkeit: Kultur soll für alle Bürger:innen bezahlbar bleiben. Auffällig ist jedoch, dass bestimmte Bereiche – etwa die Musik – oft gar nicht explizit erwähnt werden.
Welche Punkte uns bei unserer Recherche besonders ins Auge gefallen sind, könnt Ihr hier nachlesen.
CDU
Das Wahlprogramm der CDU/CSU zum Thema „Kultur“ wirkt insgesamt wenig konkret. Ein Grund dafür könnte die Auffassung sein, dass Kunst- und Kulturförderung eine gemeinsame Aufgabe von Kommunen, Ländern und Bund darstellt. Im Programm wird explizit der Wunsch formuliert, den „Kulturföderalismus zu bewahren und zu stärken“.
Bezüglich der Clubkultur heißt es, dass die CDU „Clubs als Kulturorte“ anerkennen möchte – eine wichtige, aber recht allgemein gehaltene Aussage. Auch die Förderung der Kreativwirtschaft wird angesprochen, insbesondere durch Maßnahmen zur Unterstützung der Musikindustrie sowie durch eine Film- und Games-Förderung.
Ein weiterer Punkt im Wahlprogramm ist das Thema „Erinnerungskultur“, das jedoch ebenfalls recht vage bleibt und keine konkreten Maßnahmen erkennen lässt. Insgesamt fehlen klare und detaillierte Konzepte, wie die CDU/CSU die kulturelle Landschaft in Deutschland gezielt stärken und weiterentwickeln möchte.
SPD
Die SPD positioniert sich in ihrem Wahlprogramm klar für Vielfalt in Kunst und Kultur. Um der „Bedeutung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft einen festen Platz“ zu sichern, strebt sie an, diesen Bereich als Staatsziel in der Verfassung zu verankern.
Ein zentraler Punkt ist die Forderung nach fairer Bezahlung und sozialer Absicherung für Künstler:innen. Dazu soll die Künstlersozialkasse weiter ausgebaut werden. Auch die Filmförderung nimmt einen wichtigen Platz im Programm ein: Die SPD plant, diese durch ein steuerliches Anreizsystem und eine Investitionsverpflichtung für internationale Streaming-Plattformen zu stärken.
Um Kulturorte wie Clubs vor Verdrängung zu schützen, schlägt die Partei die Einführung von „Kulturschutzgebieten“ im Baurecht vor.
Das Thema „Erinnerungskultur“ findet ebenfalls Erwähnung im Wahlprogramm, wird jedoch nach unserem Eindruck recht allgemein gehalten, ohne konkrete Maßnahmen oder Zielsetzungen auszuarbeiten.
Insgesamt legt die SPD ein Programm vor, das wichtige Aspekte der Kulturpolitik aufgreift, jedoch in Teilen konkretere Ausführungen vermissen lässt.
Bündnis 90/Die Grünen
Auch bei den Grünen fällt auf, dass sie – ähnlich wie die SPD – für Vielfalt in Kunst und Kultur stehen. Um Kunst und Kultur in der Gesellschaft den Stellenwert zu geben, den sie verdienen, soll auch nach den Grünen dieser Bereich als Staatsziel in der Verfassung verankert werden.
Positiv hervorzuheben ist, dass die Grünen an einigen Stellen nicht nur Themen ansprechen, sondern auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen formulieren. So soll beispielsweise das Gewerbemietrecht angepasst werden, um Theater, Kinos, Clubs und Bibliotheken besser vor Verdrängung zu schützen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist der „Deutschlandfonds“, der nach dem Verständnis der Grünen auf Bundesebene auch den Kulturbereich stärken soll. Durch die Entlastung der Kommunen sollen diese freiwerdende Mittel in Kulturprojekte investieren. Allerdings stellt sich die Frage, ob dies unter den vielfältigen Herausforderungen und knappen Haushalten auf kommunaler Ebene tatsächlich so umsetzbar ist oder ob der Kulturbereich am Ende dennoch zu kurz kommt. Diese potenzielle Gefahr bleibt abzuwarten.
Darüber hinaus sieht das Wahlprogramm der Grünen den Ausbau des Kulturpasses vor, der Jugendlichen den Zugang zu Kultur erleichtern soll. Auch im Bereich der Filmförderung und der Stärkung der sozialen Lage von Künstler:innen gibt es Parallelen zur SPD. Die Grünen setzen dabei besonders auf eine „angemessene Vergütung“ im Bereich des Urheberrechts.
Insgesamt zeigt sich, dass die Grünen und die SPD in der Kulturpolitik viele Überschneidungen aufweisen, wobei die Grünen an manchen Stellen durch klarere Umsetzungsansätze auffallen.
FDP
Auch die FDP zeigt im Bereich Kulturpolitik Parallelen zu SPD und Grünen, insbesondere mit ihrer Forderung, „Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern“. Darüber hinaus wirkt das Wahlprogramm der FDP im Kulturbereich jedoch – zumindest aus unserer Sicht – sehr vage und oberflächlich.
Das Programm greift einige allgemeine Themen auf, bleibt dabei aber ohne konkrete Umsetzungsansätze. So wird beispielsweise von „hervorragenden Rahmenbedingungen“ zur Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft gesprochen. Was genau damit gemeint ist oder wie diese Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, bleibt jedoch unklar.
Einzig bei der Unterscheidung zwischen E- und U-Kultur wird ein etwas konkreterer Vorschlag erkennbar: Die FDP spricht sich dafür aus, diese Trennung aufzuheben, was einen modernen und inklusiveren Blick auf die kulturelle Landschaft widerspiegeln könnte.
Die Linke
Die Linke schlägt, ähnlich wie die Grünen, vor, die Kommunen durch finanzielle Entlastungen des Bundes in die Lage zu versetzen, Kulturförderung besser umzusetzen. Besonders interessant fanden wir den Vorschlag, „paritätisch besetzte Gremien und Jurys“ bei der Vergabe von Kulturfördermitteln einzuführen, um mehr Gerechtigkeit und Vielfalt zu gewährleisten. Zudem setzt sich die Partei für Mindeststandards bei der Honorierung von Kunst- und Kulturarbeit ein. Der Bundeszuschuss an die Künstlersozialkasse soll erhöht werden, jedoch bleibt offen, wie die dafür nötigen Mittel bereitgestellt werden sollen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Ausweitung des „Mietendeckels“ auf kulturelle Einrichtungen, sodass diese von einer solchen Regelung profitieren könnten. Darüber hinaus gibt es allgemeinere Aussagen zu Themen wie der Integration von Kulturplanung in die städtische Entwicklung und der Rechtsprechung im Bereich „unrechtmäßig erworbener Kulturgüter“.
AfD
Im Programm der AfD fällt der Schwerpunkt auf die „Erinnerungskultur“ auf. So heißt es: „Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben.“ Neben diesem Thema betont die Partei, dass Kultur eine Angelegenheit der Länder sei und kulturpolitische Aktivitäten des Bundes eingeschränkt werden sollten. Gleichzeitig fordert sie, die deutsche Sprache im Grundgesetz als Staats- und Amtssprache festzuschreiben.
BSW
Zum Thema Kultur finden sich im Wahlprogramm der BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) fast ausschließlich allgemeine Hinweise. Ein zentrales Anliegen scheint die bessere soziale Absicherung von freischaffenden Künstler:innen zu sein, weshalb eine Reform der Künstlersozialkasse vorgeschlagen wird. Darüber hinaus unterstützt die Partei das Vorhaben, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Konkretere Maßnahmen oder Umsetzungspläne konnten wir jedoch nicht erkennen.
Fazit: Kultur zählt leider (noch) nicht zum politischen Herzstück
Ein starkes Kulturprogramm zur Bundestagswahl hätte nicht nur den Künstler:innen, sondern der gesamten Gesellschaft geholfen. Es hätte verdeutlicht, dass Politik mehr ist als Zahlen und Gesetzestexte – dass sie auch Raum für Visionen, Werte und Identität schafft.
Eine Gesellschaft, die in ihre Kultur investiert, stärkt nicht nur ihren inneren Zusammenhalt, sondern auch ihre Offenheit für Neues. Deshalb ist es an der Zeit, dass Kulturpolitik den Stellenwert erhält, der ihr zusteht – nicht als Randthema, sondern als essenzieller Bestandteil jeder politischen Agenda.