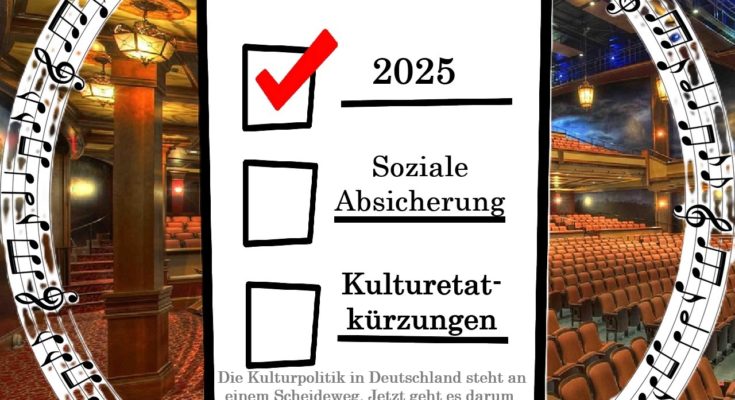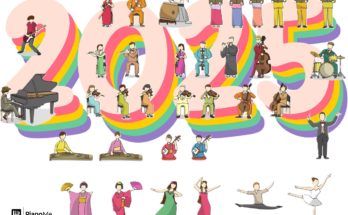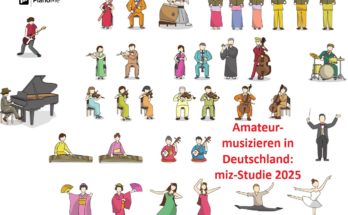Die Bundestagswahl ist vorbei, und Deutschland steht vor einer neuen politischen Ära. Während große Themen wie Klimaschutz, Wirtschaft und Sozialpolitik die Schlagzeilen dominieren, stellt sich eine entscheidende Frage: Wohin steuert die Kulturpolitik? Welche Perspektiven eröffnen sich für Kunst, Theater, Musik und kulturelle Bildung in Deutschland? Dieser Frage widmen wir uns im folgenden Artikel. Um den Rahmen nicht zu sprengen, konzentrieren wir uns auf ausgewählte Schwerpunkte – insbesondere solche, die für Musiker:innen von Bedeutung sind.
Kulturpolitik: Mehr als ein Randthema
Kultur ist weit mehr als Unterhaltung. Sie ist Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt, stärkt die Demokratie und schafft Räume für kritische Auseinandersetzung. Dennoch wird Kulturpolitik in der politischen Debatte häufig als zweitrangig behandelt. Gerade jetzt – nach den pandemiebedingten Einschnitten – ist eine nachhaltige Stärkung der Kulturlandschaft dringend geboten.
Herausforderungen: Was braucht die Kultur jetzt?

Die Kulturbranche hat durch die Corona-Pandemie massive Verluste erlitten. Viele Kulturschaffende kämpfen weiterhin mit deren Folgen. Die neue Bundesregierung ist nun gefordert, tragfähige Konzepte zu entwickeln, um diese Defizite auszugleichen – nicht nur über kurzfristige Hilfen, sondern durch langfristige Förderprogramme.
Ein zentrales Thema bleibt die soziale Absicherung von Künstler:innen. Viele sind freiberuflich tätig und haben keinen Zugang zu klassischen Sicherungssystemen. Gefragt sind unbürokratische Lösungen wie ein erleichterter Zugang zur Künstlersozialkasse oder passgenaue Sozialversicherungsmodelle für Soloselbständige. Einige Ansätze – etwa aus dem Projekt „Systemcheck“ – liegen bereits vor und könnten als Grundlage für weiterführende Gespräche oder gesetzgeberische Initiativen dienen.
Ein weiterer Diskussionspunkt, der zuletzt hohe Wellen schlug, betrifft die Umsatzsteuerbefreiung im Kulturbereich. Musikpädagog:innen und Verbände argumentieren, eine Befreiung könne die kulturelle Bildung stärken und Musikunterricht für mehr Familien erschwinglich machen. Kritiker:innen hingegen befürchten Steuerausfälle und Wettbewerbsverzerrungen. Derzeit ist das Thema bis 2027 auf Eis gelegt – eine tragfähige, praxistaugliche Lösung bleibt eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung.
Etatkürzungen: Eine wachsende Sorge
Derzeit sorgen Kürzungen der Kulturetats in Berlin, Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern für erhebliche Unruhe in der Kulturszene. In Berlin stehen nicht nur kleinere Initiativen, sondern auch etablierte Kulturinstitutionen vor drastischen Einsparungen. Auch in NRW sind Mittelkürzungen geplant, die sowohl kommunale Kulturprojekte als auch freischaffende Künstler:innen erheblich treffen könnten. Kulturverbände schlagen Alarm: Eine derartige Reduzierung öffentlicher Förderung birgt das Risiko langfristiger struktureller Schäden, da viele Projekte maßgeblich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Zwar liegt die Kulturhoheit laut Grundgesetz bei den Ländern – dennoch sind verbindliche bundesweite Rahmenbedingungen notwendig. Der Bund bleibt trotz föderaler Zuständigkeiten ein unverzichtbarer Akteur in der deutschen Kulturpolitik.
Honoraruntergrenzen: Ein Schritt gegen Prekarität
en not Um der prekären Situation vieler Kulturschaffender entgegenzuwirken, haben zahlreiche Institutionen in den vergangenen Jahren Honoraruntergrenzen empfohlen. Ziel dieser Empfehlungen ist es, zu verhindern, dass Künstler:innen und Kulturtätige zu Dumpinglöhnen arbeiten müssen. Besonders im freien Theater, bei Musikdarbietungen und in der Bildenden Kunst gibt es verstärkte Bestrebungen, faire Mindesthonorare durchzusetzen. Doch weil es meist an rechtlicher Verbindlichkeit mangelt, können viele Auftraggeber:innen diese Vorgaben leicht umgehen.
Hier ist die Politik gefragt: Sie könnte durch verbindlichere Regelungen dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen in der Kulturbranche langfristig zu verbessern. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine staatliche Einmischung ins Marktgeschehen, sondern um die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen – klar definierter Spielregeln, die Vertrauen schaffen und es den Akteur:innen ermöglichen, eigenverantwortlich zu agieren.
Denkbar wäre etwa die Einrichtung einer unabhängigen, fachlich besetzten Arbeitsgruppe, die bundeseinheitliche Honorarstandards erarbeitet – ähnlich wie in anderen Branchen bereits praktiziert. Auch andere Instrumente ließen sich nutzen, um faire und transparente Bedingungen im Kulturbereich nachhaltig zu verankern.
Lösung des Problems des Proberaumproblems
Der Mangel an geeigneten Proberäumen ist seit Jahren eine zentrale Herausforderung für Musiker:innen, Theatergruppen und andere Kulturschaffende. Die Politik könnte hier gezielt Anreize schaffen, um leerstehende Immobilien – etwa ehemalige Bürogebäude oder Schulräume – für kulturelle Zwecke nutzbar zu machen. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und privaten Eigentümer:innen bietet Potenzial. Als kurzfristige Übergangslösung könnten mobile Proberäume oder temporäre Zwischennutzungen dienen. Notwendig wäre in jedem Fall ein spürbarer Abbau bürokratischer Hürden, damit die Länder ihre kulturpolitischen Gestaltungsspielräume besser entfalten können.
Koalitionsvertrag 2025: Was die neue Regierung für Kultur plant

Kulturförderung in Stadt und Land: Ein zentrales Ziel der neuen Bundesregierung scheint die Stärkung kultureller Infrastruktur in ländlichen und strukturschwachen Regionen zu sein. Allerdings entsteht bei uns der Eindruck, dass der Fokus weniger auf neuen Förderansätzen liegt, sondern bestehende Programme wie „Kultur macht stark“ oder „Kultur in ländlichen Räumen“ lediglich weitergeführt werden. Weitere Maßnahmen sollen im Hintergrund auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Neue, zeitgemäße Programme konnten wir dem Koalitionsvertrag bisher nicht entnehmen. Geplant ist offenbar der Ausbau von Bibliotheken und Stadtteilkulturzentren sowie die regelmäßige Möglichkeit zum freien Eintritt in bundesgeförderte Kultureinrichtungen, um den Zugang zur Kultur zu erleichtern.
Soziale Absicherung und Arbeitsbedingungen: Nach unserer Einschätzung plant die Bundesregierung konkrete Schritte zur Verbesserung der sozialen Situation von Künstler:innen. Dazu zählen der Erhalt und die finanzielle Stabilisierung der Künstlersozialkasse sowie die Verankerung von Mindesthonoraren in Förderrichtlinien des Bundes. Entscheidend ist jedoch, dass diese Vorhaben mit einer generellen Erhöhung des Kulturetats einhergehen. Andernfalls droht eine Umverteilung: mehr Förderung für wenige – und insgesamt weniger kulturelles Angebot für alle.
Sonstige Schwerpunkte: Als weitere gesetzliche Rahmenbedingungen sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Eine zeitnahe Reform des Filmförderungsgesetzes mit steuerlichen Anreizen und Investitionsverpflichtungen. Aus unserer Sicht könnten solche Verpflichtungen insbesondere kommerzielle Streamingdienste dazu anhalten, einen Teil ihrer in Deutschland erzielten Einnahmen wieder in den hiesigen Kultursektor zurückfließen zu lassen.
- Auch eine Anpassung der Baunutzungsverordnung im Hinblick auf Clubs ist vorgesehen. Nach Einschätzung der PianoMe-Redaktion sollen Clubs und Livemusikspielstätten künftig als kulturelle Einrichtungen und nicht mehr – wie bislang – als Vergnügungsstätten gelten. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein entsprechender Gesetzentwurf zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung vom Bundesbauministerium in die Länder- und Verbändeanhörung eingebracht. Darin ist vorgesehen, den neuen Nutzungstypus „Musikclubs“ in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufzunehmen.
Weitere geplante Maßnahmen betreffen die konsequentere Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte, den Schutz kreativer Werke, die rechtliche Absicherung gemeinnütziger journalistischer Angebote sowie die Überarbeitung des Deutsche
Fazit
Die im Koalitionsvertrag formulierten Absichten – etwa zur Rolle des Bundes als verlässlicher Partner für Kultureinrichtungen, die Freie Szene und die Breitenkultur, zur Fortführung von Sonderinvestitionen, zur Stärkung der Kulturstiftung des Bundes und der acht Bundeskulturfonds sowie zur Berücksichtigung von Mindestgagen und Honoraruntergrenzen in Förderprogrammen – werfen eine zentrale Frage auf: Wie lassen sich diese Vorhaben finanziell solide realisieren?
Die Kulturpolitik in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Jetzt zeigt sich, ob die neuen politischen Akteur:innen Kultur als unverzichtbaren Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklung begreifen und entsprechend handeln. Die kommenden Monate werden zeigen, ob und wie Kultur wieder den politischen Stellenwert erhält, der ihr zusteht. Die Szene ist bereit – nun muss die Politik den Rahmen schaffen.
@ PianoMe Redaktion